Vorige Woche erschien ein neuer Bericht an den Club of Rome. Titel: „Enduring Peace in the Anthropocene”. Ohne Fragezeichen! Paul Shrivastava und Sandrine Dixson-Declève schreiben dazu im Vorwort: Anstatt eines einheitlichen Berichts als gemeinsames Statement „haben wir viele unserer Mitglieder eingeladen, ihre eigenen Ansichten und Bedenken zu Frieden und Krieg in ihren eigenen Worten und in ihrem eigenen Stil zu äußern.“
Es geht um Gaza und die Ukraine – aber auch weit darüber hinaus. Es geht um eine Kultur des Friedens, um Menschlichkeit und Versöhnung, Ethik und Gerechtigkeit – um einen „positiven Frieden“, wie Sandrine Dixson-Declève es nennt. Den „Frieden neu denken – jenseits patriarchaler Paradigmen“, nennt etwa Petra Künkel ihren Artikel, während Matias Lara Otilia Rose-Marie Meden die Möglichkeit einer jugendgeführten Konflikttransformation vorstellen. Mamphela Ramphele aus Südafrike schreibt über „Konflikte als Symptome unserer Selbstverleugnung“.
Und Ugo Bardi verweist auf Aurelio Peccei, der vor 60 Jahren auf die Bedeutung kalter und heißer Kriege für ein wissenschaftlich fundiertes Verständnis der Herausforderungen der Menschheit erkannte, die der Club of Rome als „global probematique“ bezeichnet hat.
Paul Shrivastava verweist in dem Bericht auf die UN Charta von 1945, in deren Präambel wir, „die Völker der Vereinten Nationen“, uns verpflichtet haben, „fest entschlossen … zusammenzuwirken“, um
- künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat,
- …
und für diese Zwecke
- …
- internationale Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker zu fördern.
Jetzt, in 2025 schreibt Shrivastava: “We need to fully understand the systems and culture of war and killing that we live in today. Key support for our war system comes from the global military-industrial network and global defence expenditures, which doubled from $1.1 trillion in 2001 to $2.2 trillion in 2022, accounting for 2.3% of the global GDP. Enabling these war expenditures are extractive fossil and mining economies, nationalist jingoistic politics, religious and linguistic rivalries, and patriarchic values. We need transdisciplinary actions that would help resolve international and intergroup conflicts without resorting to violence or oppression…”
Und er zitiert noch einmal Aurelio Peccei, “if people are free from want and fear, the world will be in peace.” Spannend finde ich dabei diese Inbeziehungsetzung von „äußeren“ und „inneren“ Bedingungen von Krieg und Frieden. Bedürfnisse und Ressourcen, Angst und Ausgaben für Rüstung. Hard- und Software sozusagen.
Schon vor einem Jahr haben wir unsere Initiative Futures of Communities sich bei unserem Workshop im Rahmen der Wiener Klimabiennale der „Emergence of Love“ gewidmet.
Und was machen wir jetzt damit? Was können wir tun? Als Österreicher*innen, als Umweltbewegte, als engagierte Bürger*innen?
Die Umweltbewegung, der ich mich seit 50 Jahren zugehörig fühle, scheint angesichts all der anderen Weltprobleme ins Hintertreffen zu geraten. Und eine neue „Friedensbewegung“ ist noch garnicht entstanden. Neulich war ich bei der ersten öffentlichen Veranstaltung von FriedensATTAC mit meinen 65 Jahren einer der jüngeren im Saal. Der Vortrag von Heinz Gärtner, den Veranstalter Gerhard Kofler als „Neutralitäts-Papst“ vorstellte, hat mir dabei die Augen geöffnet.
Jetzt erinnere ich mich an die 1980er Jahre, die Zeit meiner Politisierung, als wir 2 mal mit 70.000 andern vom Westbahnhof zum Rathausplatz marschiert sind, um den „NATO Doppelbeschluss“ zur Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen zu verhindern. Ähnlich wie heute wurde die Friedensbewegung auch vor 40 Jahren verunglimpft: wir würden naiv den „Feind“ – damals die Sowjetunion – unterstützen.
Die Frage aus dem Publikum, warum es heute keine nennenswerte Friedensbewegung gibt, konnte Gärtner nicht beantworten. Ein Grund scheint mir, dass es heute (noch) nicht gelungen ist, die Friedensbewegung breiter aufzustellen. Damals waren nach meiner Erinnerung die großen Themen Umwelt, Entwicklung, Emanzipation, Bildung, Gesundheit, Demokratie und eben Frieden viel enger mit einander verbunden – inhaltlich und personell. „Greenpeace“ trägt diese Verknüpfung seit 1971 im Namen.
„Friedens- und Umweltbewegung haben gemeinsame Wurzeln, die weit zurück reichen“, erzählte mir neulich die Umwelthistorikerin Verena Winiwarter von der Akademie de Wissenschaften in einem Interview über die super-gefährlichen Altlasten der Rüstungsproduktion, das immer noch auf meiner Festplatte schlummert und darauf wartet, transkribiert und veröffentlicht zu werden.
Ich war in den letzten Wochen in mindestens drei Meetings zur Rohstoffproblematik, in denen von mehreren Teilnehmer*innen geäußert wurde, es fehle ihnen an Wissen, um gegen die angebliche Notwendigkeit einer Aufrüstung in Österreich/Europa/Westen zu argumentieren. Jetzt denke ich über ein Format zur inhaltlichen Schaffung einer solchen Wissensbasis nach.
Gemeinsam mit anderen Zeit-Zeug*innen und einschlägigen Expert*innen möchte ich einfach zugängliche Informationen in einem Seminar/Webinar qualifiziert zur Diskussion stellen. Der „Militärisch-industrielle Komplex“, den auch Paul Shrivastava erwähnt (siehe oben) zieht neben Geld auch natürliche Ressourcen von privatem Konsum und Daseinsvorsorge (Bildung, Gesundheit, Gemeinschaftsgüter…) ab und lenkt sie in die Rüstung um. Wir leisten uns äußere Sicherheit auf Kosten eines Schutzes der Infrastruktur, die letztlich unsere Demokratie schützt, Siehe dazu den Beitrag von Rudolf Scholten vom österreichischen Club of Rome.
Aber was sind die Alternativen? Für ein Land wie Österreich gäbe es nur zwei Alternativen, meinte Heinz Gärtner in seinem Vortrag: sich unter den Schutz eines militärisch starken Partners oder Bündnisses zu stellen oder eben Neutralität, wie sie in Österreich seit 70 Jahren praktiziert wird. Diese müsse glaubwürdig sein, wozu durchaus auch eine gewisse militärische Verteidigungsbereitschaft gehöre, und aktiv, worunter er die Bereitschaft versteht, in Konflikten zu vermitteln. Als Atom(waffen)freies Land mit einem von vier UNO-Amtssitzen hätte Österreich da gute Voraussetzungen und in der Vergangenheit auch viel geleistet. Womit wir wieder bei Hard- und Software wären.
Und eine neue Friedens-Bewegung ist durchaus im entstehen. Hier in Wien gibt es derzeit schon beinahe täglich wenn auch kleine Veranstaltungen und Kundgebungen. Darüber würde ich gerne mehr berichten. Der neue Papst Leo XIV hat das Thema Frieden ganz ins Zentrum seines Pontifikats gestellt: „In unserer Zeit erleben wir noch immer zu viel Zwietracht, zu viele Wunden, die durch Hass, Gewalt, Vorurteile, Angst vor dem anderen und durch ein Wirtschaftsmodell verursacht werden, das die Ressourcen der Erde ausbeutet und die Ärmsten an den Rand drängt“ sagte er bei seiner Inauguration.
Die Wiener Festwochen haben unterdessen die „Republik der Liebe“ ausgerufen und auch beim Eurovision Song Contest in Basel war viel von „Liebe“ die Rede. Man mag das als Show abtun. Für mich hat es sich bei der Festwocheneröffnung auf dem Rathausplatz unter vielen jungen Menschen und auch beim ESC-Fernsehabend doch recht stimmig angehört.
Und ähnliches habe ich schon vor ein paar Wochen in (m)einem persönlichen Manifest formuliert. Demnächst läuft übrigens „One to one: John&Yoko” in den österreichischen Kinos.
Darauf freue ich mich schon. Make Love, not war!
Let’s go for it!
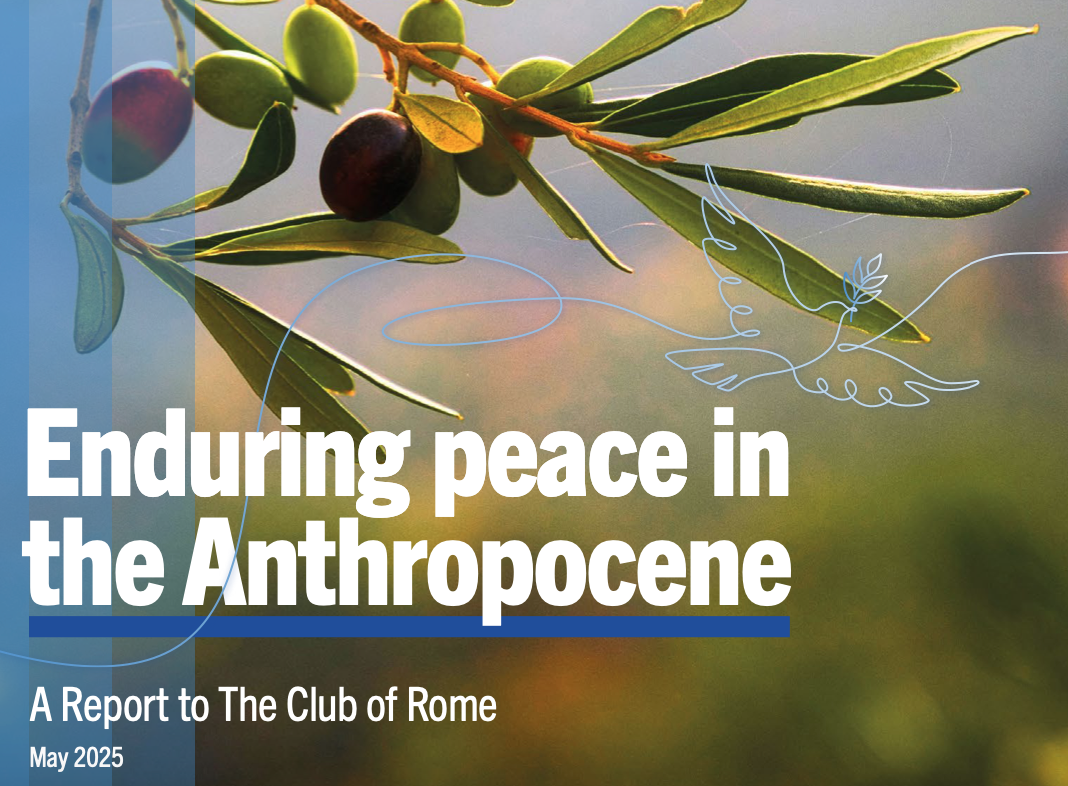
Pingback: „Earth4All“ beim Forum Antrhopozän 2025 – Fritz Hinterberger
Pingback: (Welt-)Kriegs-Tagebuch – Fritz Hinterberger